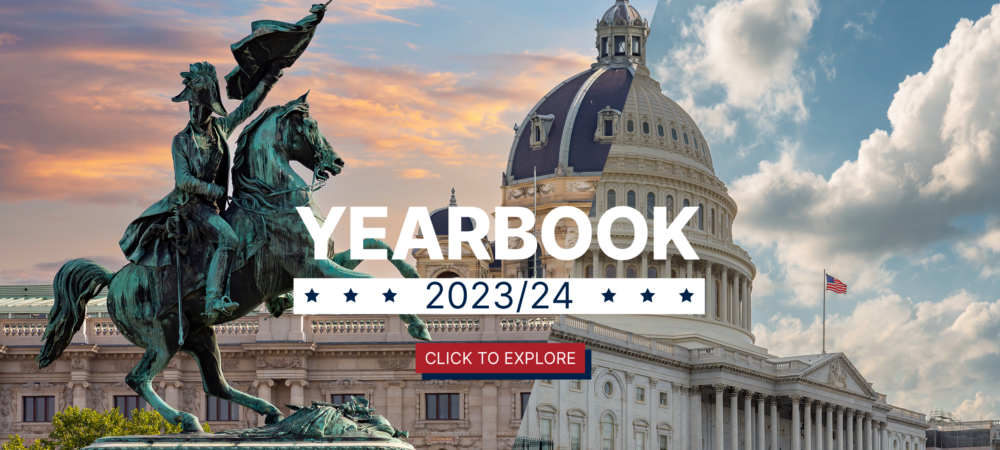Your benefits
as a member
Opportunities & Events
AmCham Austria hosts regular events and networking opportunities for members to connect with other business leaders and decision-makers in the US-Austria trade community.
AmCham Austria provides information and resources on economic and policy issues relatedto US-Austria trade and investment.
As a member of AmCham Austria you have access to the resources and support of the US embassy in Austria, including the ability to connect with political decision makers in the US and Austria.
AmCham Austria represents the interests of its members in policy discussions and advocacy efforts.
Upcoming
Events
Now available…
AmCham Austria App
Get your ultimate AmCham app!
Gain exclusive access to tailored content, effortlessly browse and register for industry events, relive memorable moments with our photo gallery, connect with professionals through our directory, and stay informed and inspired with our news page.
Download the AmCham Austria app for great opportunities and meaningful connections, so that you stay connected, informed and involved.

Access exclusive connections and use the opportunity to network with like-minded personalities!
Our member directory contains a large number of valuable connections that you can easily find in our mobile app.
Stay up to date with our news page!
Get personalized news and industry insights right at your fingertips, keeping you informed, relevant and able to make better decisions in today’s fast-paced world.
Experience seamless event registration with our new app feature!
With just a few taps, you can now register for events directly from our app, ensuring you never miss a chance to connect and learn.